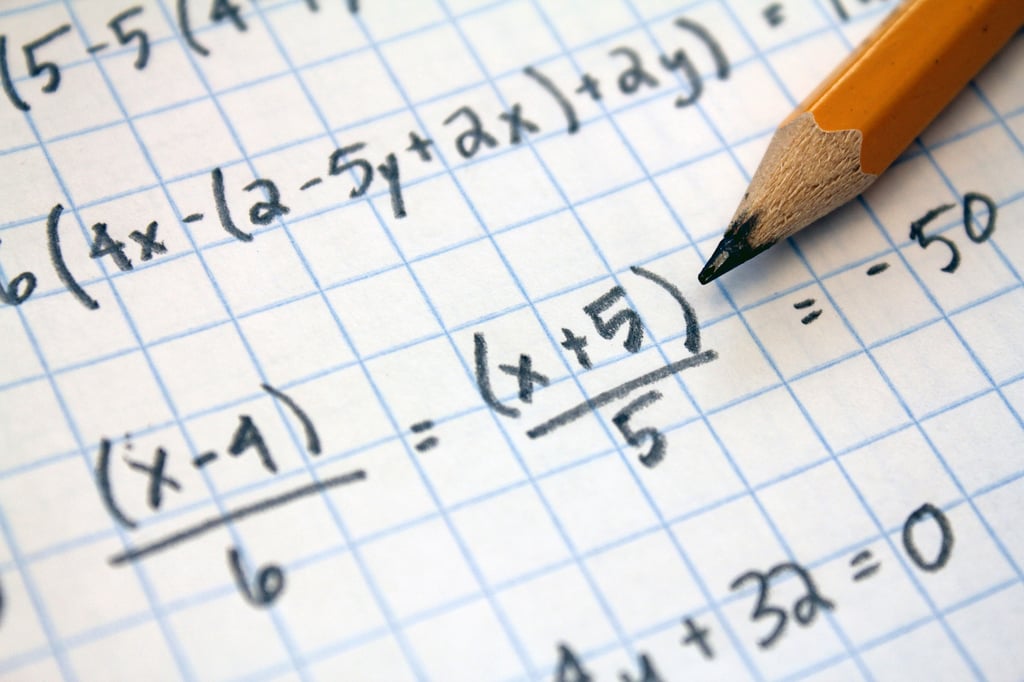Die Frankfurter Prozesse gegen die Nazi-Verbrechen
Und Peter Weiss "Die Ermittlung"

Nel 1963 hanno luogo a Francoforte i processi contro i crimini nazisti ad Auschwitz. Peter Weiss li porta in scena nel suo pezzo teatrale Die Ermittlung (L’istruttoria) e presenta al pubblico un’aula di tribunale con imputati che si coprono a vicenda e cercano di affievolire le loro colpe, e con testimoni che rivivono le loro sofferenze, raccontandole ai giudici.
Dieses Jahr jähren sich zum 60. Mal die Frankfurter Auschwitzprozesse gegen die Nazi-Verbrecher. Peter Weiss hat in seinem Theaterstück Die Ermittlung das Ereignis verarbeitet und dem großen Publikum vorgestellt.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden von den Alliierten die Nazi-Verbrechen aufgedeckt. Es handelte sich um Kriegsverbrechen und um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Totschlag, Folterung und Versklavung von Zivilisten waren in Arbeits- und Vernichtungslagern und in Ghettos gegen Juden, Zigeuner und Regimegegner an der Tagesordnung.
In den Nürnberger Prozessen nach dem Krieg stellte man die Hauptverantwortlichen dieser Verbrechen vor ein Militärgericht. Allerdings waren viele Nazi-Verbrecher vor allem nach Südamerika geflohen, oder hatten sich in die neue Gesellschaft integriert.
In der sowjetischen Besatzungszone – später DDR – war der Entnazifizierungsprozess gründlicher.
Ende der 1950er Jahre wurde in der Bundesrepublik deutlich, dass viele NS-Verbrecher noch nicht bestraft worden waren und sich in der deutschen Gesellschaft frei bewegten. Man setzte sich daher mit der Nazi-Vergangenheit intensiver auseinander und gründete in Ludwigsburg die Zentralstelle zur Aufdeckung der Nazi-Verbrechen.
Infolgedessen verhandelte man ab 1963 in Frankfurt am Main in den Auschwitzprozessen gegen die Lagermannschaften von diesem Vernichtungslager.
Die Angeklagten schützten sich gegenseitig: Sie wollten sich selbst nicht belasten und sagten aus, dass sie nur Befehle ausgeführt und gehorcht hätten. In den Prozessen wollte man darauf keine Rücksicht mehr nehmen, jedoch wurde dies im Urteil strafmildernd berücksichtigt.
An diesen Prozessen nahmen Zeugen teil, die Auschwitz überlebt hatten. Ihre Aussagen waren für sie psychologisch sehr belastend: Denn damit mussten sie diese grausame Zeit noch einmal durchleben und über die Lebensverhältnisse im Lager berichten.
Nur sechs Angeklagte wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Die anderen bekamen mildere Strafen, so dass ein Teil der öffentlichen Meinung auch international darauf empört reagierte. Aber auf diese Weise wurde das Thema wieder aufgegriffen und gehörte auch zur Debatte der 68er-Studentenbewegung.
Peter Weiss, der am 8. November 1916 bei Potsdam geboren ist, war jüdischer Abstammung und musste während der Nazi-Herrschaft emigrieren. Er lebte bis zu seinem Tod 1982 in Schweden und wurde auch schwedischer Staatsbürger. In seinen Werken beschäftigte er sich u. a. mit der deutschen Vergangenheit, und in seinem Theaterstück Die Ermittlung zeigt er einen Teil der Gerichtsverhandlung.
Die Ermittlung hat Peter Weiss zwei Jahre nach den Frankfurter Prozessen gegen Nazi-Verbrecher veröffentlicht. Es handelt sich um ein Theaterstück, das den Prozess mit seinen ganzen Widersprüchen und Ungerechtigkeiten zeigen will. Die Ermittlung ist von Brechts epischem Theater beeinflusst. Weiss zeigt dem Publikum auf sachliche Weise, wie verhandelt wurde, es soll sich selbst eine Meinung bilden und selbst verstehen, was noch ungerecht und ungesühnt geblieben ist. Das Stück gliedert sich in elf Gesänge - nach dem Vorbild von Dantes Göttlicher Komödie - und jeder Gesang behandelt ein Thema aus dem Lagerleben.
Die Angeklagten tragen ihre wirklichen Namen und versuchen während des ganzen Prozesses, sich gegenseitig zu decken und ihre Taten zu beschwichtigen.
Die Zeugen haben keinen Namen, sondern nur eine Nummer (wie sie in den Lagern nur eine Nummer hatten und eine Nummer waren). Sie stehen stellvertretend für Millionen von Menschen, die alle möglichen Grausamkeiten in den Lagern erlebt haben. Ihre Aussage hat sie viel gekostet, denn sie mussten diese traumatische Zeit noch einmal durchleben.
Obwohl bei diesen Prozessen die Strafen allgemein zu mild waren, haben die Gerichtsverhandlungen dafür gesorgt, dass die Nazizeit wieder in die öffentliche Diskussion gebracht wurde.
Referenze iconografiche: ©shutterupeire / Shutterstock
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden von den Alliierten die Nazi-Verbrechen aufgedeckt. Es handelte sich um Kriegsverbrechen und um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Totschlag, Folterung und Versklavung von Zivilisten waren in Arbeits- und Vernichtungslagern und in Ghettos gegen Juden, Zigeuner und Regimegegner an der Tagesordnung.
In den Nürnberger Prozessen nach dem Krieg stellte man die Hauptverantwortlichen dieser Verbrechen vor ein Militärgericht. Allerdings waren viele Nazi-Verbrecher vor allem nach Südamerika geflohen, oder hatten sich in die neue Gesellschaft integriert.
In der sowjetischen Besatzungszone – später DDR – war der Entnazifizierungsprozess gründlicher.
Ende der 1950er Jahre wurde in der Bundesrepublik deutlich, dass viele NS-Verbrecher noch nicht bestraft worden waren und sich in der deutschen Gesellschaft frei bewegten. Man setzte sich daher mit der Nazi-Vergangenheit intensiver auseinander und gründete in Ludwigsburg die Zentralstelle zur Aufdeckung der Nazi-Verbrechen.
Infolgedessen verhandelte man ab 1963 in Frankfurt am Main in den Auschwitzprozessen gegen die Lagermannschaften von diesem Vernichtungslager.
Die Angeklagten schützten sich gegenseitig: Sie wollten sich selbst nicht belasten und sagten aus, dass sie nur Befehle ausgeführt und gehorcht hätten. In den Prozessen wollte man darauf keine Rücksicht mehr nehmen, jedoch wurde dies im Urteil strafmildernd berücksichtigt.
An diesen Prozessen nahmen Zeugen teil, die Auschwitz überlebt hatten. Ihre Aussagen waren für sie psychologisch sehr belastend: Denn damit mussten sie diese grausame Zeit noch einmal durchleben und über die Lebensverhältnisse im Lager berichten.
Nur sechs Angeklagte wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Die anderen bekamen mildere Strafen, so dass ein Teil der öffentlichen Meinung auch international darauf empört reagierte. Aber auf diese Weise wurde das Thema wieder aufgegriffen und gehörte auch zur Debatte der 68er-Studentenbewegung.
Peter Weiss, der am 8. November 1916 bei Potsdam geboren ist, war jüdischer Abstammung und musste während der Nazi-Herrschaft emigrieren. Er lebte bis zu seinem Tod 1982 in Schweden und wurde auch schwedischer Staatsbürger. In seinen Werken beschäftigte er sich u. a. mit der deutschen Vergangenheit, und in seinem Theaterstück Die Ermittlung zeigt er einen Teil der Gerichtsverhandlung.
Die Ermittlung hat Peter Weiss zwei Jahre nach den Frankfurter Prozessen gegen Nazi-Verbrecher veröffentlicht. Es handelt sich um ein Theaterstück, das den Prozess mit seinen ganzen Widersprüchen und Ungerechtigkeiten zeigen will. Die Ermittlung ist von Brechts epischem Theater beeinflusst. Weiss zeigt dem Publikum auf sachliche Weise, wie verhandelt wurde, es soll sich selbst eine Meinung bilden und selbst verstehen, was noch ungerecht und ungesühnt geblieben ist. Das Stück gliedert sich in elf Gesänge - nach dem Vorbild von Dantes Göttlicher Komödie - und jeder Gesang behandelt ein Thema aus dem Lagerleben.
Die Angeklagten tragen ihre wirklichen Namen und versuchen während des ganzen Prozesses, sich gegenseitig zu decken und ihre Taten zu beschwichtigen.
Die Zeugen haben keinen Namen, sondern nur eine Nummer (wie sie in den Lagern nur eine Nummer hatten und eine Nummer waren). Sie stehen stellvertretend für Millionen von Menschen, die alle möglichen Grausamkeiten in den Lagern erlebt haben. Ihre Aussage hat sie viel gekostet, denn sie mussten diese traumatische Zeit noch einmal durchleben.
Obwohl bei diesen Prozessen die Strafen allgemein zu mild waren, haben die Gerichtsverhandlungen dafür gesorgt, dass die Nazizeit wieder in die öffentliche Diskussion gebracht wurde.
Referenze iconografiche: ©shutterupeire / Shutterstock